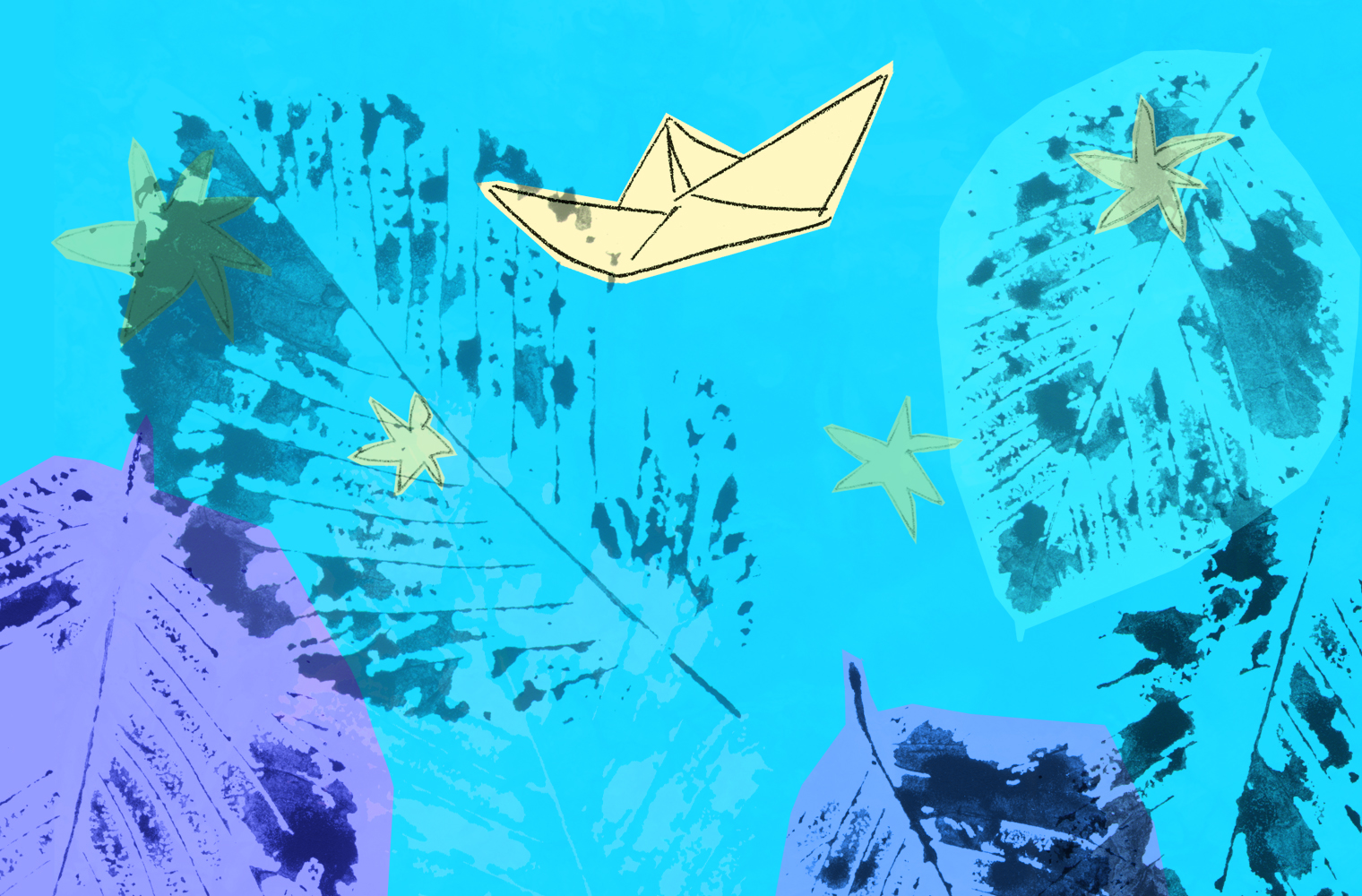
Jesper wird in die Stille einer Julinacht geboren, vor den Fenstern des Krankenhauses verdecken Buchen den Sternenhimmel nur zu Teilen. Die Hebamme legt ihn seiner Mutter auf den Bauch, zündet eine Kerze an und entfernt sich aus dem Kreißsaal.
Schwangerschaft: Jesper * 24. 7. 2014 † 17. 7. 2014
Das Kind in Lisas Bauch ist schwerstbehindert, Ärzte raten zur Abtreibung. Die Eltern suchen nach ihrer Antwort auf eine der schwierigsten Fragen des Lebens.
Am Morgen nach der Geburt schickt Björn alle aus dem Zimmer. Eine Stunde allein mit seinem Sohn, den er im Arm hält, um ihn willkommen zu heißen. Und zu verabschieden. Vorsichtig öffnet er dessen geschlossene Lider und schaut in klares, tiefes Blau.
Fünf Monate vorher, an einem Tag im Februar, flimmern Grau-, Schwarz- und Weißtöne grobpixelig auf dem Monitor des Pränataldiagnostikers. Der Arzt misst Knochen und Organe schweigend. Als er endlich redet, sitzt Lisa noch auf der Untersuchungsliege, Björn neben ihr auf einem Stuhl. Ein Herzfehler. Ein Teil der Bauchorgane des Embryos, der Darm und wahrscheinlich auch die Leber hängen in einer Art Beutel durch eine Öffnung der Bauchdecke im Fruchtwasser. Ein komplexes Fehlbildungssyndrom, vermutlich Trisomie 13 oder 18. Eine Diagnose wie ein Schadensbericht. Defekt. Ein defektes Kind.
„Das wird eine harte Schwangerschaft. Und ein hartes Leben mit dem Kind, wenn es überlebt. Sie können bei uns abtreiben.“ „Gibt es Selbsthilfegruppen?“ „Nein. Die Kinder sterben sowieso immer gleich. Gucken Sie bloß nicht ins Internet.“ Der Pränataldiagnostiker hat keine Worte, die das Ergebnis fassbar und verständlich machen. Kein Hilfsangebot. Er vermittelt kein Beratungsgespräch und keinen Psychologen. Zwei Wochen bis zum nächsten Termin.
Lisa liest alles, was sie finden kann. Fachbücher, Broschüren, Blogs. Kinder mit diesen Chromosomenstörungen werden von den Müttern selten ausgetragen. Schon bei der meist viel harmloseren Trisomie 21 treiben 90 Prozent aller Eltern das Kind ab, wenn sie von der Behinderung erfahren. Wenn sie nicht abgetrieben werden, sterben Kinder mit Trisomie 13 oder 18 oft während der Schwangerschaft. Manche leben nur ein paar Tage, manche aber auch Jahre. Lisa hört von Kindern mit Reflux, Atemproblemen und Krämpfen, sieht Bilder von Babys mit einer Nase, über das ganze Gesicht verwachsen. Ohne Augen. Mit Mund- und Nasenspalten.
Eine Freundin fragt: „Was hast du denn für eine Intuition?“ Lisa sagt: „Das Kind geht seinen Weg. Es soll bleiben.“ Aber sie weiß auch, dass sie jemand ist, der zwar ein Bauchgefühl hat, einen Impuls, aber trotzdem das Bedürfnis, die Vernunft nicht auszublenden. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, das ist wichtig für sie. Sie will sich hinterher keine Vorwürfe machen. Sie weiß noch nicht, wie sie entscheiden wird. Wenn sie überhaupt über das Leben und den Tod ihres Kindes entscheiden kann, dann muss sie wissen, was seine Krankheit bedeutet. Was sein Leben bedeuten würde. Und was sein Tod. Sie muss noch mehr über das Kind wissen.
Björn hat das Gefühl, dass Lisa ihm meilenweit voraus ist, schon angekommen im Muttersein. Sie hat eine Haltung zu dem Kind, er sucht sie noch. Und steigt erst ein, als Lisa einen Film findet. Mein kleines Kind, ein Dokumentarfilm über eine Hebamme, die ihr nicht lebensfähiges Kind im Kreis von Freunden und Angehörigen zu Hause auf die Welt bringt, wo es wenig später stirbt.
Eine andere Hebamme sitzt ein paar Tage später bei ihnen im Wohnzimmer. Sie hat schon Tausende Kinder entbunden, gesunde Kinder und Kinder mit Behinderungen. Sie hat fast 40 Berufsjahre hinter sich. Sie sagt: „Soweit ich weiß, führt kein Weg an den lebensverlängernden Maßnahmen vorbei. Jeder Arzt und jede Hebamme ist dazu verpflichtet. Wenn ihr das nicht wollt, wird es schwer. Dann braucht ihr juristischen Beistand.“ Als sie die Wohnung verlässt, fühlen sich die beiden allein und ratlos.
Für Kinder mit Behinderung gilt die Abtreibungsgrenze von 14 Schwangerschaftswochen nicht, sie dürfen bis kurz vor der Geburt mit einer Kaliumchloridspritze ins Herz getötet werden. Die Spritze – für Björn ist das der rote Knopf. „Ich will nicht den roten Knopf drücken“, sagt er. Aber sie beide haben Angst vor einem Leben mit einem so schwer behinderten Kind. Was ist, wenn Lisa es austrägt und es dann lebt, noch lange lebt, an Apparate angeschlossen dahinvegetiert? Dem eigenen Kind kein langes Leben zu wünschen, das ist ein verstörender Gedanke.
„Seine Badewanne ist perfekt für ihn“
Lisa hat Angst davor, dass das Kind sie isoliert. Auch von anderen Eltern. Weil man mit einem kranken Kind nicht dazugehört. Keine gemeinsamen Spaziergänge mit dem Kinderwagen. Mitleid statt Freude. Pflege zu Hause. Bei zwei einfühlsamen Beraterinnen von der Diakonie informieren sie sich, welche staatlichen Hilfen es gibt für Eltern von Kindern, die so schwer behindert sind. Einer von uns wird immer bei dem Kind sein, denken sie, jede Minute. Hilfen für Förderung und Betreuung scheint es nur wenige zu geben, auf verwirrend viele Ämter verteilt. Vielleicht wären sie im Krankenhaus, vielleicht auch mal zu Hause. Vielleicht braucht das Kind eine Beatmungsmaschine. Was können sie aushalten?
In Berlin-Mitte hat ein renommierter Professor seine Praxis für Pränataldiagnostik. Vielleicht weil eine Freundin ihn empfohlen hat, versprechen sich Lisa und Björn viel von dem Termin. Jemand, der ihnen endlich etwas Genaueres sagen kann und der weiß, was passiert, wenn das Kind geboren ist. Wieder sehen sie den Embryo in Pixeln, diesmal in einem größeren Raum, mit dem Beamer an eine Leinwand projiziert. Lisa erkennt auf den Bildern die Hände, sie findet sie wunderschön. Der Arzt sagt, die Stellung der Hände mit den überkreuzten Fingern deute stark auf eine Trisomie hin. Er hat die größere Leinwand, aber die gleiche Botschaft wie sein Kollege. In Lisas Bauch ist ein Problem. Ein kranker Mensch, nicht lebenswürdig. Auf dem Heimweg sieht Lisa die Friedrichstraße mit ihren fünfstöckigen Häusern und den Passanten durch einen Schleier aus Tränen. Nicht lebenswürdig. Sie ist wütend wegen dieser Bewertung. Und fühlt sich gleichzeitig verbunden mit dem Kind.
Björn und Lisa sind in diesen Wochen besessen von der Notwendigkeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Mal sind sie sich einig und dann wieder nicht. „Du sollst nicht töten“ ist für Björn ein humanistischer Kernsatz, mehr als ein religiöses Gebot. Ich will nicht über dieses Leben entscheiden, denkt er. Und hat gleichzeitig Angst, die Kontrolle zu verlieren. Die beiden skypen mit einer Familientherapeutin aus Dänemark, treffen sie kurz darauf in Hamburg. Sie reden über das Gefühl, alles nur falsch machen zu können. Einen richtigen Weg scheint es nicht zu geben. Sie sagt: „Ihr macht das gut, ihr seid schon weit.“
Als sie sich von der Frau verabschieden, versteht Lisa Björn besser und Björn Lisa. Aber trotzdem gibt es keine gemeinsame Entscheidung. Er will seinen Sohn weder töten lassen noch ein Sterben auf Raten ermöglichen. Die Entscheidung fühlt sich viel zu groß an. Er will nicht getrieben sein. Björn hasst es, unter Druck zu stehen. Er macht die Dinge gerne gründlich und gut, das braucht Zeit. Lisa will entscheiden, weil mit jedem Tag das Baby wächst, eine Abtreibung weniger infrage kommt.
In den nächsten Wochen redet Lisa mit einem buddhistischen Mönch, der zugleich Frauenarzt ist. Sie besichtigt einen Bauernhof, auf dem Kinder mit Behinderung leben. Über den Verein Leona wendet sie sich an Eltern, deren Kinder mit Trisomie 13 oder 18 trotzdem 16 Jahre alt geworden sind. In jedem Gespräch wird klar, wie sehr diese Kinder geliebt werden. Lisa spielt alle Varianten durch, auch, das Kind notfalls allein zu bekommen, ohne Björn. Dann merkt sie, dass ihn selbst das unter Druck setzen würde. Auch ein anderer Gedanke taucht kurz auf und verschwindet wieder. Sie ist 38. Während sie dieses Kind austrägt, vergeht vielleicht wertvolle Zeit.
Und dann löst sich nach allen Enttäuschungen mit Ärzten ausgerechnet in der Berliner Charité, dem größten Krankenhaus Europas mit seinen endlos langen Fluren, der große Knoten. „Jetzt geht es Ihrem Kind gut“, sagt Christoph Bührer, der Chef der Neonatologie, zur Begrüßung, „seine Badewanne ist perfekt für ihn“. Der Kardiologe sagt: „Solche Herzfehler haben wir schon operiert, das kriegen wir hin.“
Lisa und Björn sind dankbar für diese Sätze, dafür, dass endlich jemand nicht nur ein Problem sieht, sondern einen Menschen; ihren Sohn, der es wert ist, operiert zu werden. Hier sind Ärzte, die Kinder wie ihn schon gesehen haben, nicht nur auf dem Bildschirm. Auch die Kinderchirurgin sagt, dass man die Omphalozele, die Bauchorgane im Sack außerhalb des Körpers, operieren kann. Aber es fehlt noch etwas, ein Gesamtbild. Die Puzzleteile müssen noch zusammengefügt werden.
Der Pränataldiagnostiker ruft eine Konferenz zusammen. Am Tisch sitzen vier Mediziner. Schnell wird klar: Jede einzelne Operation wäre möglich, alle zusammen wären wohl zu viel. Besonders belastend wäre die Bauchoperation, bei der zur Vorbereitung die Organe im Nabelschnurbruchsack über einem Brutkasten aufgehängt werden und dann über viele Tage langsam in den Bauchraum einsickern. „Das ist nicht schön für ein Neugeborenes, das eh schon viel zu verkraften hat“, sagt Neonatologe Bührer. „Aber eine Abtreibung ist auch nicht schön“, sagt Lisa.
Schon wieder diese Aussichtslosigkeit. Und dann schlägt der Arzt das vor, was sie später den palliativen Weg nennen. Das Kind zur Welt bringen und bei ihm sein, wenn es stirbt, möglichst ohne Schmerzen. Der Arzt spricht aus, was Lisa und Björn denken, ohne dass sie es hätten formulieren können. Das Kind hat ein Recht auf sein Leben und gleichzeitig darauf, dass nicht alles Mögliche getan wird. Trotz der Traurigkeit fühlt Lisa sich jetzt gelöst. Björn ist froh, dass es nun einen Fahrplan gibt.
Ein kleines Wikingerboot aus Lärchenholz
Aber es tauchen immer wieder Fragen auf. Die beiden durchdenken sie gemeinsam mit Hebammen und Ärzten. Was passiert, wenn das Kind nicht atmet? Schließen sie es an eine Beatmungsmaschine an? Wenn nicht – quält es sich dann beim Sterben? Es gibt kein endgültiges Ergebnis, sondern ein Übereinkommen, schriftlich festgehalten: Nach der Geburt wollen sie gucken, was sinnvoll erscheint. Sollte ihr Sohn kräftig sein, wollen sie ihn operieren lassen. Der „Leitstern“, wie Lisa es nennt, ist, dem Kind möglichst viel gute Zeit zu schenken. Mit Körperkontakt und wenig Intervention. Zum Fahrplan gehört auch, endlich die Schwangerschaft zu genießen. Björn wollte lange keine Kinder, dann hatte Lisa zwei frühe Fehlgeburten. So lange hatte sie sich gewünscht, schwanger zu sein, dass sie jetzt alles auskostet. Den Bauch, der immer größer wird, die Tritte von innen. Das hat viel mit Zugehörigkeit zu tun, sagt sie, das zu erleben, was andere Frauen auch erleben. Eine wesentliche Erfahrung. Zu den schönsten Momenten gehört, wenn Fremde auf der Straße gratulieren, fragen, wann es so weit ist, ob es ein Junge ist oder ein Mädchen. Dann ist es so, wie es sein soll, reine Freude, kein Mitleid, keine Trauer.
Es hat lange gedauert, die Entscheidung zu treffen, aber jetzt sind sich Lisa und Björn einig. Und sie sind überzeugt. So überzeugt, dass es keine Kommentare gibt, wie andere Eltern von Kindern mit Behinderung sie häufig hören: Warum sie sich das kranke Kind antun, ob man sich das nicht hätte sparen können. Von Anfang an haben sie ihre Gedanken und Zweifel mit ihren Freunden und ihrer Familie geteilt. Die stehen jetzt hinter ihnen. Dabei sein zu können, hat etwas von einem Privileg – zu sehen, wie aus einer Katastrophe etwas Gutes wird. Warum leben wir? Woher kommen wir? Was passiert, wenn wir sterben? Was brauchen wir, um Abschied zu nehmen? Die Fragen, die sich Lisa und Björn stellen, stellen sie sich nicht allein, ihre Freunde und ihre Familie suchen auch Antworten, mitten im Alltag. Wie soll jemand, der diesen Rückhalt nicht hat, mit so einer Situation klarkommen, überlegt Lisa und sagt später, dass diese Zeit Björn und sie zusammengeschweißt habe.
Beide wissen, dass die Schwangerschaft wahrscheinlich die einzige Zeit ist, die sie mit ihrem Sohn haben werden. Sie suchen einen Namen, der zu der großen, alten Seele passt, als die sie ihn empfinden, und nennen ihn weiterhin bei einem Kosenamen. Fahren in den Urlaub nach Cinque Terre: Meer und Berge, kleine Dörfer und Blumen. Sie singen ihm Lieder vor und besichtigen Friedhöfe.
Fürchterlich findet Björn die ordentlichen Gräber in ihrer Stadt. Fürchterlich sind für ihn auch die kleinen zusammengetackerten Kindersärge, die ihm die Bestatter zeigen, in die er sein Kind nicht betten will. Er findet sie unpersönlich, wie Entsorgungskisten. „Ich kann nicht viel für meinen Sohn tun“, sagt Björn, „aber einen Sarg kann ich bauen“. Zusammen mit einer Freundin, die Bootsbauerin ist, zimmert er aus Lärchenholz ein kleines Wikingerboot mit durchgehendem Kiel und Planken. Und einem Deckel. Später, in der Kapelle, in der sie mit Freunden und Verwandten Abschied nehmen, wird das Boot neben Blumensträußen und Kerzen stehen, auf blauen Tüchern voller Blüten.
Wo soll das Kind begraben sein, was soll es anziehen, wo soll es zur Welt kommen? Der Schmerz mischt sich unter das Schöne. In Berlin-Prenzlauer Berg, im Zentrum des Babybooms, nehmen die beiden an einem Geburtsvorbereitungskurs teil, sitzen wie die anderen Paare auf blauen Matten und Gummibällen. Die Kinder der anderen werden alle leben. Wie lange ihr Sohn durchhält, ob sie ihn jemals lebend im Arm halten können, wissen sie nicht. Bei einem Spaziergang auf einem alten Berliner Friedhof entdecken sie eine Ecke mit Kindergräbern, die sie nicht erschrecken. Eichhörnchen flitzen die Bäume hoch. Hier gibt es eine Kapelle und eine Friedhofsverwaltung, die bereit ist, Ausnahmen zu machen. Björn will nicht nur den Sarg selbst bauen, er will mit Lisa auch das Grab ausheben, den Sarg allein zum Grab tragen.
Ende Juli, drei Wochen vor dem Geburtstermin, nach einem müden Tag, an dem Lisa Unterlagen sortiert und aufräumt, merkt sie, dass keine Kindsbewegungen mehr da sind. Das Baby ist nicht so kräftig wie gesunde Kinder, die Tritte haben oft Stunden, manchmal Tage auf sich warten lassen. Aber diesmal ist es anders. Ihr Kind ist tot. Der Wehenschreiber auf der Liege der Frauenärztin zeigt keine Herztöne mehr an. Auf einmal ist alles schon geschehen, und sie müssen hinterherkommen. Lisa fühlt sich wie ein Stein. Ihre Hände krampfen, alles ist ein einziger Krampf, und gleichzeitig ist sie zu schwach, um lange die Muskeln anzuspannen. Trotzdem tanzt sie, zu Piazzolla, Musik voller Zärtlichkeit und Trauer. Auch auf der Beerdigung wird Lisa tanzen. Björn liest einen eigenen Text.
Das Kind schien vollkommen
Zusammen fahren sie ans Meer, Schwäne dümpeln auf dem Wasser. Sie machen ein Feuer, singen die Lieder, die sie für ihren Sohn gesungen haben, haben das Gefühl, noch einmal zu dritt zu sein. Später, als alles vorbei ist, wird dies der Ort sein, an den sie zurückgehen, wenn sie sich erinnern wollen.
Jesper wird in die Stille einer Julinacht geboren, vor den Fenstern des Krankenhauses verdecken Buchen den Sternenhimmel nur zu Teilen. Die Hebamme legt ihn seiner Mutter auf den Bauch, zündet eine Kerze an und entfernt sich aus dem Kreißsaal. Lisa und Björn säubern ihn vorsichtig und nabeln ihn ab. Eine Nacht lang liegt er in einem Korb neben ihnen. Wieder fühlen sie verschieden. Lisa hat es schwer. Das Kind in ihr schien vollkommen, groß, heil. Auch wenn er keine Nasenspalte hat, keine hässlichen Missbildungen, auch wenn alle Gliedmaßen dran sind, alle Finger, alle Zehen: Er ist versehrt. Nicht lebensfähig. Es dauert, bis sie die Bilder übereinkriegt.
Björn sagt, dass er erst in dem Augenblick Vater geworden ist, als er seinen Sohn sehen, anfassen, riechen konnte. Ihm, der lange kein Kind gewollt hatte, fällt die Vaterschaft mit dem Kind in die Arme. Dass es tot ist, macht für ein paar Minuten keinen Unterschied. „Du bist wie verwandelt“, sagt Lisa. Schon jetzt merken sie, dass viel von Jesper bleiben wird.
Fünf Tage sind sie bei dem Körper im Krankenhaus, holen ihn jeden Tag für ein paar Stunden zu sich, bringen ihn am Abend zurück in die Kühlung. Die Großeltern kommen. Sie treffen sich für eine Abschiedsfeier. Es gibt Bilder aus den Tagen, sie zeigen Lisa und Björn auf einem Krankenhausbett neben einem zarten Kinderkörper. Ein feines Gesicht. Die Omphalozele verbunden auf seinem Bauch.
In den Räumen, wo Jesper geboren wurde, in der Stille und im Dunklen, mit den Buchen vor dem Fenster, taucht fast zwei Jahre später sein Bruder mit Augen von stark verwaschenem Dunkelblau bei Tageslicht aus dem Wasser, bevor er nach Luft schnappt, seinen ersten Schrei tut, die Arme bewegt, die Beine.
Autorin Anke Lübbert ist mit Lisa und Björn befreundet. Sie hat den Entscheidungsprozess der Eltern aus der Nähe miterlebt und rückblickend aufgeschrieben. Alle Namen wurden auf Wunsch der Betroffenen hin geändert.
Dieser Artikel wurde erstmals in „dasbuchalsmagazin.de“ und dann in der ZEIT, Nr. 29 vom 7. 7. 2016 veröffentlicht.

