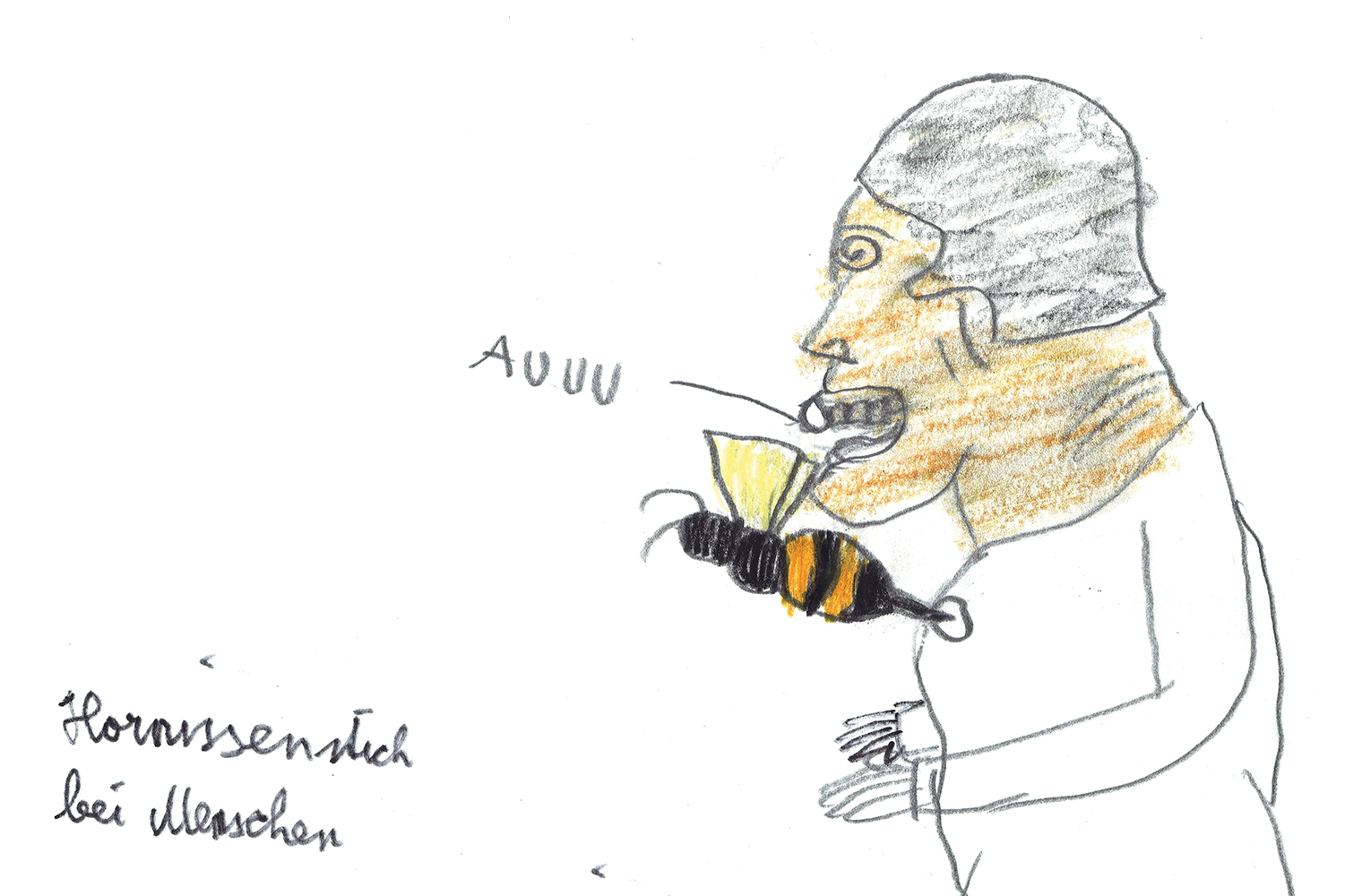
Christian Rebhan, Hornissenstich bei Menschen, Mischtechnik auf Papier, 25 x 35 cm, 2018. Christian Rebhan ist ein Künstler der Kunstwerkstatt Lebenshilfe Gmunden und Mitglied des Kunstvereins Kunstforum Salzkammergut.
Vertrauen oder Verlässlichkeit?
In der sonderpädagogischen Praxis tut man oft so, als sei ohne Vertrauen keine professionelle Beziehung möglich. Zumindest scheint dies als Axiom über der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu schweben. Man müsse „erst einmal Vertrauen schaffen“ oder „ohne Vertrauen geht nichts“ sind Sätze, die man immer wieder hören kann, besonders dann, wenn es schwierig wird, man nicht weiter weiß, sich Vertrauen nicht einstellen will oder dieses zerbrochen scheint.
1. Vertrauen – Überlegungen zu einem komplexen Phänomen
Wenn Vertrauen eine derart selbstverständliche Grundlage für sonderpädagogische Beziehungsgestaltung ist, dann müsste die Sonderpädagogik auf eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit Vertrauen zurückblicken können. Doch dies ist nicht der Fall (Müller 2016, 86ff.). Zwar weisen wichtige Bezugsdisziplinen wie Philosophie, Soziologie und Psychologie eigenständige, teils sehr unterschiedliche geführte Diskussionen und Begriffsbildungen zu Vertrauen auf; doch in der Sonderpädagogik findet sich keine Auseinandersetzung. Lediglich die Allgemeine Pädagogik liefert einige historische Anhaltspunkte (ebd., 50ff.), nicht aber eine systematische Analyse und Betrachtung des Vertrauensphänomens. Die Gründe hierfür mögen sehr unterschiedlich sein, zuvorderst aber mag die Zuschreibung von Vertrauen als Basis sonderpädagogischer Beziehungsgestaltung zu selbstverständlich zu sein, als dass eine Thematisierung notwendig erscheint. Hinzu kommt, dass die Bemühungen der Nachbardisziplinen zeigen, wie ungemein schwer es ist, Vertrauen zu bestimmen und zu fassen – und: wie uneins man sich dabei sein kann (ebd., 24ff.).
Dennoch: Überlebenswichtig erscheint für Menschen ein gewisses Maß an (Grund-)vertrauen zu sein: Man denkt beispielsweise nicht darüber nach, ob es richtig ist, das Haus zu verlassen, weil man umkommen könnte; oder nicht mehr zu atmen, weil die Luft vergiftet sein könnte. Reflektierte man alle Eventualitäten des Seins mit Blick auf eine mögliche Zukunft, dann überforderte dies individuell derart, dass man nicht lebensfähig wäre. Vertrauen reduziert also die Komplexität von Welt (Luhmann 2009), aber: Man scheint auch zu einer Art von Vertrauen verdammt zu sein.
Besonders seltsam ist das Verhältnis von Vertrauen und Zeit. Bisweilen kennt man jemanden kaum und vertraut dieser Person schon nach kürzester Zeit. Andere Menschen kennt man sehr lange, weiß im Grunde, dass man ihnen vertrauen kann und zögert doch. Man sagt, Vertrauen brauche lange, um aufgebaut zu werden und sei schnell zerstört. Das stimmt aber nur bedingt, denn man denkt nicht lange über Vertrauen nach, sondern vertraut einfach. Es muss kein Zeitmaß zurückgelegt werden und dann vertraut man, sondern es stellt sich ein oder auch nicht. Doch ist Vertrauen erst einmal zerstört, kommt es nicht so schnell zurück, selbst wenn alles dafürspräche, wieder neu zu vertrauen. Vertrauen ereignet sich, noch bevor man darüber nachdenken kann, ob es gerechtfertigt wäre. Es ist demnach ein Phänomen mit präreflexiven Anteilen, was seine wissenschaftliche Zugänglichkeit und Untersuchung nicht einfach macht. Das meint aber nicht, dass Vertrauen nicht rational sei. Vielleicht kann man sich nicht bewusst entscheiden, zu vertrauen oder nicht; oft gibt es aber gute Gründe, weshalb man vertraut. Diese guten Gründe (Hartmann 2011) haben meist mit Handlungen zu tun, die ausgeführt oder unterlassen werden und so das Vertrauen beeinflussen.
Im Alltag verwendet man Vertrauen und Verlässlichkeit meist gleichbedeutend. Es gibt jedoch einen großen Unterschied: Man muss nicht vertrauen, wenn man sich verlässt. Sich-Verlassen bindet sich „nur“ an bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten. Vertrauen dagegen enthält immer ein Moment an Verlässlichkeit. Diese bezieht sich darauf, dass der andere mit dem erwiesenen Vertrauen wohlwollend (ebd.) umgeht, zumindest aber, dass einem kein Schaden zugefügt wird (Laucken 2001, 24ff.). Im Kontext der sonderpädagogischen Arbeit mit emotional-sozial förderbedürftigen Kindern und Jugendlichen erscheint folgendes bedeutsam: „Alles, was wir (…) sagen können, ist, dass Vertrauensverhältnisse anders als Verhältnisse des Sich-Verlassens-Auf zwar auf unterstellter Rücksichtnahme des Vertrauensempfängers beruhen, die Art und Weise der Rücksichtnahme aber nicht ohne Verweis auf konkrete, auch historisch [bzw. biografisch; T.M.] variable Beziehungsformen spezifiziert werden kann“ (Hartmann 2011, 182).
Vertrauen erscheint vordergründig gut, ist aber kein nur positiv besetztes Phänomen, worauf die Formulierung des „blinden Vertrauens“ verweist. Gerade die Sonderpädagogik weiß um viele biographisch belastete Kinder und Jugendliche, denen man nicht mehr, sondern weniger Vertrauen wünschen würde; bei denen gesundes Misstrauen angebrachter wäre als blindes Vertrauen. Hinzu kommt: Wird man zu einem „Vertrau mir!“ aufgefordert, ist es wohl eher angeraten, skeptisch zu werden, denn man muss dem Vertrauen sprachlich nicht auf die Sprünge helfen, es stellt sich ganz von selbst ein. Wenn man sich dem anderen als vertrauenswürdig ausweisen will, dann gelingt dies nur über das, was man in seinen Handlungen tut oder unterlässt.
Es lässt sich also in aller Kürze festhalten: Vertrauen bezieht sich auf andere und ist daher an Erwartungen gebunden. Es bedeutet zu akzeptierten, dass man verletzt werden könnte und geht dennoch mit einem Ermessensspielraum einher. Es ist nicht rational, hat aber Gründe und verlangt, auf Kontrolle zu verzichten. Es ist etwas Anderes als Verlässlichkeit und „ereignet“ sich, noch bevor man darüber nachdenken kann.
2. Vertrauen und Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialem Förderbedarf
Die biographischen Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf sind oft von Ohnmachtserleben, Beschämung, Bloßstellung, Gewalterfahrungen und Missbrauch geprägt. Dieser Förderbedarf, der durchaus attestiert werden kann und muss, geht wesentlich auf entsprechende Negativerfahrungen, oft mit Erwachsenen und spezifischen Lebensverhältnissen, zurück. Dies zu erwähnen ist wichtig, denn in der personalistischen Rede vom Förderbedarf wird meist nur das „Ergebnis“, eben in Form eines Bedarfs, der meist allein beim Kind gesehen wird, benannt. Ist von Inklusion die Rede, so müssten auch die Lebenssituationen von Familien und betroffenen Kindern und Jugendlichen in den Blick geraten: Was heißt Inklusion in Hinsicht auf soziale Benachteiligung und Armut, auf Arbeitslosigkeit und psychische Erkrankung, auf „soziale Vulnerabilität“ (vgl. Castel 2000) und „prekären Wohlstand“ (vgl. Hübinger 1999)?
Unabhängig davon, aber in hohem Maße abhängig von den hier aufgeführten Lebenserfahrungen und -umständen, könnte es daher sein, dass diese Kinder weniger als andere bereit und/oder in der Lage sind zu vertrauen, weil es ihnen weniger möglich ist, (weitere) Verletzungen zu akzeptieren. Das Maß der biographischen Verletzungen, das sie hinnehmen mussten oder müssen, scheint bereits mehr als voll: Verletzt und enttäuscht aus individuell bedeutsamen Beziehungen, sind die Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen nicht nur Ergebnis dieser, sondern lassen zudem ahnen, wie schwer, vielleicht unmöglich, es sein mag, das Moment der Verletzbarkeit in vertrauensvollen Beziehungen zu akzeptieren, so dass sie diese von vorne herein für sich ausschließen (müssen) oder sich auf diese nicht (mehr) einlassen können. Wevelsiep weist darauf aus anthropologischer Perspektive und mit besonderem Blick auf Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialem Förderbedarf hin: „Das Kind kommt in der Ungeschütztheit seiner ganzen Person auf den Pädagogen zu. Das heißt, es zeichnet sich nicht durch einen Mangel aus, den der Professionelle beheben kann, sondern es wendet sich an den Professionellen in der Ungeschütztheit, einem gewissen Ausgeliefert-Sein, die es (…) mitbringt. (…) Es gibt Brüche in der primären Welt sozialer Erfahrungen, die tiefgreifende (…) sind: dauerhafte seelische Verwahrlosung, dauerhaft soziale und emotionale Bindungsstörungen, strukturelle und personale Gewalt, des Weiteren starke Missachtungserfahrungen in sozialen Systemen (…) Die Gründungsvoraussetzung des besonderen behindertenpädagogischen Bündnisses liegt zunächst in der Anerkennung der Verletzbarkeit des Kindes“ (2015, 85).
Vertrauen kann nur als solches bezeichnet werden, wenn es von anderen als solches erkannt und anerkannt wird. Gerade in der sonderpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf zeigt sich immer wieder neu, dass sie nicht (mehr) bereit oder fähig sind, eine vertrauensvolle Einstellung ihres Gegenübers anzuerkennen – oder vielmehr noch, dass sie dazu durchaus bereit wären, es aber nicht (mehr) können oder sich nicht erlauben (Müller 2016, 241ff.). Vertrauen ist nicht nur eine personen-, sondern auch situationsbezogene Einstellung. Dessen müssen sich insbesondere pädagogische Einrichtungen bewusst sein. Sie sind Institutionen mit allen bekannten Negativwirkungen der Macht – und Machtmechanismen können Gift für Vertrauensbeziehungen sein – gerade für diese Kinder und Jugendlichen.
Wer vertraut, erwartet zumeist, dass Vertrauen mit Vertrauen beantwortet wird und vor allem, darin nicht enttäuscht zu werden. Im Verzicht über die Kontrolle des anderen und in seiner wohlwollenden Anerkennung kann Vertrauen gelingen. Viele emotional-sozial belastete Kinder und Jugendliche müssen jedoch früh lernen, für sich selbst zu sorgen und sich zu schützen: Sie werden gegebenenfalls Mühe haben, darauf zu vertrauen, dass mit ihrem Vertrauen wohlwollend umgegangen wird.
Die Forschung zeigt, dass sich Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialem Förderbedarf Vertrauen von anderen wünschen, sich für sehr vertrauenswürdig halten und die Berücksichtigung ihrer Interessen erwarten, während sie gleichzeitig im Erweisen von Vertrauen äußerst zurückhaltend sind (Müller 2016, 241ff.). Vertrauen, das auf Wechselseitigkeit beruht, gerät damit in ein asymmetrisches Verhältnis. Diese Asymmetrie, die im Erziehungsprozess, im institutionellen Machtgefälle und in spezifischen Vertrauensgeschichten von Kindern und Jugendlichen enthalten ist, darf auch im Zuge der inklusionistischen Rede von Normalität und Gleichheit nicht übergangen werden.
Besonders am Aspekt der „akzeptierten Verletzbarkeit“ zeigt sich die mögliche Zumutung von Vertrauen für Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf. Niemand will im Zusammenhang von Vertrauen verletzt werden. Doch gerade damit hat es Sonderpädagogik vielfach zu tun: Verletzt aus individuell bedeutsamen Beziehungen, lassen Kinder durch ihr Verhalten und Erleben erahnen, wie schwer, vielleicht unmöglich, es sein mag, Verletzbarkeit in vertrauensvollen Beziehungen zu akzeptieren. Die Sehnsucht nach vertrauensvollen Beziehungen bleibt von diesen Erfahrungen oftmals unberührt – ganz im Gegenteil: Sie wächst: „Die Verletzbarkeiten zu akzeptieren, die durch das Vertrauen erst geschaffen werden, heißt, sie als reale Möglichkeiten in Kauf zu nehmen und nicht zu leugnen. Dabei geht es nicht darum, eine Überzeugung oder einen Wunsch zu akzeptieren (…) Der Begriff der Akzeptanz (…) ist in genau dem Maße eigentümlich, in dem er sich nicht auf positive Wünsche oder Absichten beziehen lässt. Das zu akzeptieren, was wir nicht wünschen, bedeutet gleichsam, die Kehrseite unserer vertrauensrelevanten Wünsche anzuerkennen und ihr ins Gesicht zu sehen“ (Hartmann 2011, 310ff.). Für Kinder und Jugendliche, die sich beispielsweise aufgrund einer Traumatisierung in bedeutsamen Beziehungen als verhaltensauffällig „zeigen“, tritt hiermit eine schier unüberwindbare Zumutung zutage.
Und doch muss wohl Welz Recht gegeben werden, wenn sie festhält: „Die Schwierigkeit besteht darin, dass keiner auf Vertrauen verzichten kann, aber alle in ihrem Vertrauen verletzlich bleiben. Deshalb kann die subjektive Angst vor dem Verwundetwerden und dem Verlieren von Vertrauen nicht dadurch kuriert werden, dass auf inter-subjektive Interdependenz verwiesen wird. Unsere wechselseitige Abhängigkeit nötigt uns zum Vertrauen, ohne dass sie verletztes Vertrauen heilen könnte“ (2010, 85). Und in genau jenem Konflikt ereignet sich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf. Für die sonderpädagogische Praxis hieße das zuerst, Zeiten und Räume zu schaffen, in denen es nicht um Lernen und Leistung, sondern um Lernen und Leben geht; und damit um die Anerkennung der Verletzbarkeit des Kindes vor dem Hintergrund seiner biographischen Erfahrungen.
Vertrauen erscheint oft als bedeutsam für pädagogische Beziehungen und doch nicht richtig fassbar. Vergegenwärtigt man sich, welche Macht man anderen im Sinne akzeptierter Verletzbarkeit einräumt, wird deutlich: Vertrauen zu erweisen, bedeutet, Macht zu schenken und sich in gewisser Weise der Mächtigkeit anderer auszusetzen, zumindest aber Machtmissbrauch zu riskieren. Im Kontext von emotional-sozial belasteten Kindern und Jugendlichen stellt sich demnach die Frage, inwieweit gerade ihnen zugetraut wird, verantwortungsvoll mit geschenktem Vertrauen umzugehen. Hier müssen sich pädagogisch Professionelle fragen, inwieweit sie bereit und fähig sind, dieses Zutrauen gerade massiv störenden, übergriffigen, sich und andere verletzenden Kindern und Jugendlichen entgegenzubringen. Denn: Wem Vertrauen geschenkt wird, dem wird auch ein Ermessensspielraum geschenkt, mit dem erwiesenen Vertrauen umzugehen, d. h. die Freiheit, dem Vertrauen nicht zu entsprechen, „weil sich die Situation oder die Bedingungen, unter denen Vertrauen geschenkt wurde, verändert haben, so dass es nicht mehr angemessen oder angebracht wäre, dem Vertrauen ohne Wenn und Aber zu entsprechen. Es liegt also nicht prinzipiell Wertvolles darin, dem geschenkten Vertrauen zu entsprechen“ (Hartmann 2011, 222). Vertrauen in der sonderpädagogischen Praxis zu überhöhen, bedeutet, es als Phänomen in seiner Qualität zu beschneiden.
Es gibt keine Praxis, die gegenseitiges Vertrauen garantiert – auch nicht in der Sonderpädagogik. Pädagogisch Professionelle können schnell scheitern, wenn sie Vertrauen moralisch aufladen und in Folge enttäuscht sind, wenn es trotz aller Bemühungen nicht erwidert wird. Aus Idealismus wird dann Enttäuschung und aus Zuwendung Abkehr. Und Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf können scheitern, wenn sie ihr enttäuschtes Vertrauen zu einem werden lassen wollen, dessen Gründe kontrolliert werden können, um weitere Brüche zu verhindern (Müller 2016, 241ff.). So nachvollziehbar dies sein mag, so sehr verhindern sie damit das Entstehen vertrauensvoller Beziehungen. Zumindest aber belasten sie bestehendes Vertrauen erheblich, wenn der andere sich nicht nur als vertrauenswürdig erweisen, sondern beweisen muss, noch bevor das Gut des Vertrauens zum Gegenstand einer gemeinsamen Praxis geworden ist.
3. Vertrauen oder Verlässlichkeit?
Das Gelingen pädagogischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die emotional-soziale Förderbedarf aufweisen, ist stark von der Beziehungsqualität abhängig, die man ihnen anbietet. Das klingt recht einfach und ist doch sehr schwer. Sie realisiert sich nur, wenn die heimlichen Curricula pädagogischer Selbstverständnisse beständig reflektiert werden. Insbesondere aber gilt es, die eigenen Verletzbarkeiten und Erwartungen zu hinterfragen, die man Kindern und Jugendlichen zumutet, ohne sich über diese bewusst zu sein. Spezifische Erfahrungen mit einseitigen Macht- und Ohnmachtsverhältnissen und ihrem Missbrauch könnten dazu führen, dass es Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf oftmals nicht oder nur schwer möglich ist, dem anderen die notwendige Freiheit der Vertrauenserfüllung zu überlassen, und sie sich somit selbst von der Erfüllung einer Vertrauenssehnsucht abschneiden (müssen). Für sie wäre schon das Sich-Verlassen-Auf als personale Erwartung an andere eine biografische Höchstleistung, weil sie durch das Fehlen oder Ausbleiben von Misstrauen gekennzeichnet ist. Die Forschung zeigt, dass Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialem Förderbedarf Verlässlichkeit durchaus als reziprokes Phänomen mit Rechten und Pflichten ansehen, während sie dies für Vertrauen nicht bestätigen wollen (vgl. Müller 2016, 282).
Transparent gemachte Verlässlichkeit kann also Herausforderung genug sein bzw. genau das Richtige. Vertrauen ist nicht der Anfang von allem – auch und gerade nicht in der sonderpädagogischen Praxis mit Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf!
Literatur
Castel, R. (2000): Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit. Konstanz.
Hartmann, M. (2011): Die Praxis des Vertrauens. Berlin.
Hübinger, W. (1999): Prekärer Wohlstand. Spaltet eine Wohlstandsschwelle die Gesellschaft? In: Aus Politik und Zeitgeschichte 18, 18–26.
Laucken, J. (2001): Zwischenmenschliches Vertrauen. Rahmenentwurf und Ideenskizze. Oldenburg.
Luhmann, N. (2009): Vertrauen. München.
Müller, T. (2016): „Ich kann Niemandem mehr vertrauen“. Konzepte von Vertrauen und ihre Relevanz für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Bad Heilbrunn.
Welz, C. (2010): Vertrauen und Versuchung. Tübingen.
Wevelsiep, Ch. (2015): Pädagogik bei emotionalen und sozialen Entwicklungsstörungen. Stuttgart.
Thomas Müller, Priv.-Doz. Dr. phil. habil.
Thomas Müller lehrt und forscht am Lehrstuhl Pädagogik bei Verhaltensstörungen, Universität Würzburg. Forschungsschwerpunkte sind Vertrauen und soziale Benachteiligung als Themen der Sonderpädagogik, beeinträchtigte und belastete Kindheit unter den gesellschaftlichen Bedingungen des 21. Jahrhunderts sowie Unterricht und Erziehung bei Verhaltensstörungen.

